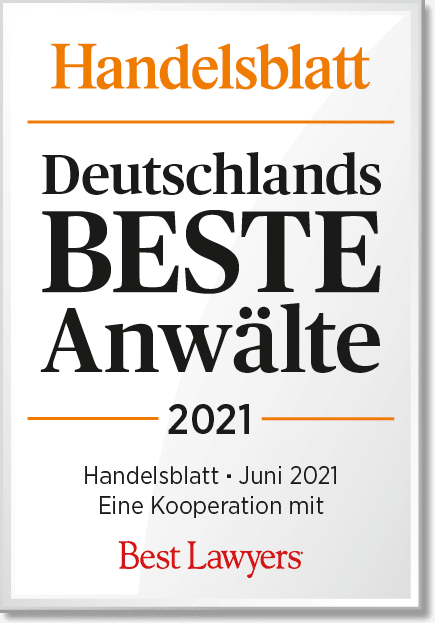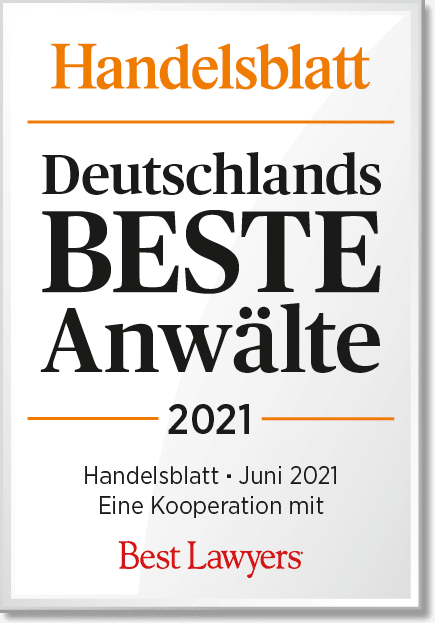Die grundbesitzende GbR im Wandel der Zeit – von einfach zu kompliziert.
Der Anfang war einfach
Am Anfang stand eine einfache Idee: Im ersten Entwurf des BGB war die Gesellschaft nach römisch-rechtlichem Vorbild (societas) als ein ausschließlich schuldrechtliches Rechtsverhältnis unter den Gesellschaftern ohne eigenes, von dem ihrer Gesellschafter verschiedenen, Gesellschaftsvermögen gestaltet (vgl. Mot. II, 591 = Mugdan II, 330). Die zweite Kommission konstituierte dann ein Gesellschaftsvermögen als Gesamthandsvermögen (vgl. die bis 2024 geltende Fassung der §§ 718, 719 BGB), ohne jedoch die aus dem Gesamthandsprinzip folgenden Konsequenzen im Einzelnen zu regeln. Es blieb vielmehr im Wesentlichen bei der Regelung des Gesellschaftsverhältnisses als Schuldverhältnis (BGH NJW 2001, 1056). Dies führte dazu, dass im Grundbuch zwar nicht die GbR als solche als Eigentümer eingetragen wurde, jedoch ihre Gesellschafter in ihrer gesamthänderischen Verbundenheit unter Angabe des Gesamthandverhältnisses. Dies gab immerhin einen Hinweis auf das Bestehen einer GbR (§ 47 GBO i.d.F. vor dem 18.08.2009).
Der Schritt in die Rechtsfähigkeit
Der BGH erkannte bereits in den 90er Jahren (siehe hier insbesondere die Entscheidung des BGH vom 4.11.1991, BGHZ 116, 86) die partielle Rechtsfähigkeit der GbR an. Mit der Entscheidung vom 29.01.2001 (BGH NJW 2001, 1056) war dann die Rechtsfähigkeit der GbR endgültig anerkannt, allerdings noch nicht ihre Grundbuchfähigkeit. Diese erlangte sie erst aufgrund des Beschlusses vom 4.12.2008 (BGH - DNotZ 2009, 115). Damit konnte die GbR erstmals unter der Bezeichnung in das Grundbuch eingetragen werden, die ihre Gesellschafter im Gesellschaftsvertrag für sie vorgesehen haben.
Mit Art. 1 Gesetz v. 11.08.2009 BGBl. I S. 2713 wurde dann durch § 47 Abs. 2 GBO bestimmt, dass, wenn ein Recht „für eine GbR“ einzutragen ist, „auch“ deren Gesellschafter im Grundbuch einzutragen sind. In Hinblick auf die damit normierte teilweise Zuerkennung der Rechtsfähigkeit der GbR wurde dann auch § 82 GBO geändert. Die Vorschrift, sah bis dahin nur generell für den Fall eines Rechtsübergangs außerhalb des Grundbuchs (z.B. durch Erbfolge) vor, dass dem Eigentümer oder dem Testamentsvollstrecker die Pflicht zur Grundbuchberichtigung auferlegt wird. Diese Möglichkeit wurde nun ausdrücklich für den Fall, dass „eine GbR als Eigentümerin eingetragen war“, entsprechend für anwendbar erklärt (§ 82 S. 3 GBO i.d.F. vom 18.08.2009). Zur Begründung führte der Rechtsausschuss an, dass „die neuen Bestimmungen (…) erforderlich (sind), weil das Recht an die veränderten Gegebenheiten angepasst werden muss, die sich aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs zur Rechtsfähigkeit der GbR und zu ihrer Eintragung im Grundbuch ergeben“ (BT-Drucksache 16/13437 - Beschlussempfehlung und Bericht Rechtsausschuss S. 23). Die Änderung der GBO (Artikel 1 Gesetz v. 11.08.2009 BGBl. I S. 2713) setzte allerdings die Rechts- und Grundbuchfähigkeit der GbR nur unzureichend um.
Infolgedessen wurde der Streit über die Art und Weise, wie z.B. die Existenz und die Identität einer GbR grundbuchrechtlich (§ 29 GBO) nachzuweisen ist, nicht erledigt. Das OLG München (Beschluss vom 5. Februar 2010 - 34 Wx 116/09) und das KG (Beschlüsse vom 22.06.2010 - 1 W 277/10 und vom 5.10.2010 – 1 W 392/10) haben jeweils die Möglichkeit, diese Nachweise zu führen, rundweg verneint. Das Problem bestand nach ihrer Ansicht darin, dass die Gesellschafter einer GbR ohne weiteres auch Gesellschafter einer anderen GbR sein konnten. Notwendig wären daher eindeutige, die Gesellschaft als unverwechselbares Rechtssubjekt identifizierende Angaben, wozu etwa Erklärungen zum Gründungsort und zum Gründungszeitpunkt, aber auch Name und Sitz (vgl. § 15 I lit. c GBV), gehören können. Da die GbR aber formlos gegründet werden kann, können diese Angaben im Regelfall nicht mit den für das Grundbuch erforderlichen Mitteln beigebracht werden. Zweifellos ein Dilemma, dem nach Auffassung beider Gerichte dogmatisch ohne eine Gesetzesänderung nicht beizukommen war. Das OLG Brandenburg hat daraus den pragmatischen Schluss gezogen, dass die fehlende Anpassung des Grundbuchrechts an die geänderte Rechtsnatur der GbR nicht zu einer Blockade des rechtsgeschäftlichen Verkehrs mit Grundstücken führen darf und sich über die dogmatischen Bedenken hinweggesetzt.
In ähnlicher Weise hat der BGH mit den praxisnahen Beschlüssen vom 28.04.2011 (BGH – V ZB 232/10 und V ZB 234/10) die Blockade beendet und dafür gesorgt, dass die GbR auch in der Praxis grundbuchfähig ist. Nunmehr stand fest, dass ein in der Form des § 29 GBO zu führender Nachweis der rechtlichen Verhältnisse einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR) zum grundbuchlichen Vollzug von Änderungen unter Beteiligung einer GbR nicht erforderlich ist. Dies hat die Dogmatiker nicht ruhig schlafen lassen.
Und noch ein Register
Die nächste Änderung kam dann mit der Reform des Personengesellschaftsrechts durch das Personengesellschaftsrechtsmodernisierungsgesetz (MoPeG) vom 10.08.2021 (BGBl. I S. 3436). Durch Art. 1 MoPeG wurden nicht nur fast sämtliche Bestimmungen der GbR geändert (vgl. die übersichtliche Synopse bei Buzer - https://www.buzer.de/gesetz/6597/v276583-2024-01-01.htm) sondern das Gesellschaftsregister (Gesellschaftsregisterverordnung – GesRV) als weiteres Register geschaffen und die dort eingetragene „eGbR“ als neue Gesellschaftsform.
Die Eintragung der GbR in das Gesellschaftsregister ermöglichte es jetzt, den Nachweis über ihre Identität zu führen. Damit konnte auch die gesetzliche Verpflichtung aufgenommen werden, die GbR in das Register einzutragen, wenn sie wiederum als Gesellschafterin einer anderen Gesellschaft eingetragen werden soll (§ 707a Abs. 1 S. 2 BGB). Weiterhin ist eine Eintragung der GbR im Register für eine Eintragung als Berechtigte im Grundbuch nach der ebenfalls neu geschaffenen Vorschrift des § 47 Abs. 2 GBO notwendig. Damit bestehen nun drei verschiedene Formen der GbR nebeneinander: Die rechtsfähige GbR, die nicht rechtsfähige (Innen-) GbR und als Unterfall zur rechtsfähigen GbR die im Gesellschaftsregister eingetragene eGbR.
Viel Aufwand ohne dogmatisch durchschlagenden Erfolg
Obgleich die Änderungen im Grundbuchrecht bereits zum 1.01.2024 in Kraft getreten sind (Art. 137 MoPeG), sind bis heut die meisten GbRs nicht im Gesellschaftsregister eingetragen. Voraussetzung für jede Eintragung eines Rechts für eine GbR im Grundbuch ist aber die Eintragung der GbR im Gesellschaftsregister. Ohne Erfüllung der jeweiligen Voreintragungspflicht wird ab dem 01.01.2024 kein Recht für eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts im Grundbuch eingetragen (§ 47 Abs. 2 GBO n.F.). Dies gilt gem. Art. 229 § 21 I EGBGB auch für die vor dem 1.1.2024 im Grundbuch eingetragenen GbR‘s (= Alt-GbR). Das hat zur Folge, dass in naher Zukunft Hunderttausende von grundbesitzenden Alt-GbRs im Gesellschaftsregister eingetragen und die Grundbücher berichtigt werden müssen, was formell aufwendig ist:
In einem ersten Schritt müssen die Gesellschafter, und zwar alle (§ 707 Abs. 4 S.1 BGB), die Eintragung der GbR in das Gesellschaftsregister in öffentlich beglaubigter Form (§ 12 Abs. 1 HGB) beantragen. Nach der Eintragung im Gesellschaftsregister genügt keineswegs ein einfacher Antrag auf Berichtigung des Grundbuchs. Zwar ist das Grundbuch unrichtig geworden, da die GbR jetzt erstmals einen Namen oder, wenn sie bereits mit einem Namen eingetragen war, einen um den Rechtsformzusatz ergänzten Namen führt. Die Berichtigung erfolgt jedoch nur aufgrund einer Berichtigungsbewilligung (§ 19 GBO), die ebenfalls von allen Gesellschaftern in beglaubigter Form (§ 29 GBO) vorgelegt werden muss. Selbst dann, wenn nach der Eintragung im Gesellschaftsregister einzelne Gesellschafter zur Vertretung der GbR berechtigt sind, muss die Änderung von sämtlichen im Grundbuch eigetragenen Gesellschaftern bewilligt werden.
Zwar hat es den Anschein, als ob dieses Verfahren besonders sicher ist und gewährleistet, dass nur diejenige Gesellschaft im Grundbuch als Eigentümer berichtigend eingetragen wird, die tatsächlich identisch mit der bereits im Grundbuch eingetragenen GbR ist. Das ist leider nicht der Fall. Alle Probleme über den Nachweis der Identität der Gesellschaft, die das OLG München und das KG im Jahr 2010 veranlasst haben, die Eintragung von Veränderungen im Grundbuch abzulehnen, bestehen weiterhin. Wie soll auch der Nachweis erbracht werden, dass die im Grundbuch eingetragene Alt-GbR mit der neu im Gesellschaftsregister eingetragenen GbR identisch ist, wenn es mehrere GbR’s mit demselben Gesellschafterbestand geben kann. Nur mithilfe der insoweit entsprechend anzuwenden Entscheidung des BGH von 2011 ist es überhaupt möglich, die Umwandlung einer GbR in eine eGbR grundbuchmäßig zu vollziehen.
Da fragt man sich schon, wozu der ganze Aufwand. Schließlich hätte man die GbR auch in eine oHG umwandeln können, ohne ein neues Gesellschaftsregister mit allem Drum und Dran erfinden zu müssen. Lediglich § 1 HGB hätte geringfügig geändert werden müssen. Aber so wurden Aufgaben für den Justizapparat geschaffen, für Notare, Rechtspfleger und auch Gerichte.
Für Fragen zu diesem Thema wenden Sie sich bitte an Dr. Probandt, Notar a.D.